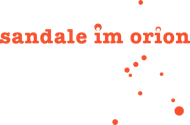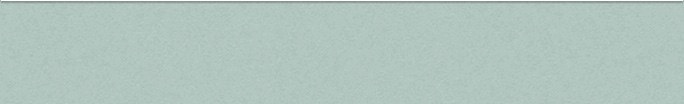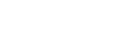Sektionsleitung:
Prof. Dr. Doerte Bischoff (Hamburg); Prof. Dr. Johannes Evelein (Hartford/CT) Assistant Prof. Dr. Patrick Farges (Paris); Prof. Dr. Simona Leonardi (Napoli); Prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (Heidelberg/Prag/Göttingen); Prof. Dr. Thomas Pekar (Tokio)
Sektionsbeschreibung: Emigration und Flucht, die oft mit Erfahrungen von Diskriminierung und Ausgrenzung im Herkunftsland und von Fremdheit im Zufluchtsland gekoppelt sind, stellen meist tiefe biographische Brüche dar, die eine Herausforderung für die Versprachlichung bedeuten. Dies betrifft nicht nur die Frage nach der Erzählbarkeit von traumatisch Erlebtem, sondern berührt ebenso Fragen der narrativen Konstruktion von Gemeinschaft und Zugehörigkeit sowie Problematisierungen nationaler Selbstverständigungs- und Erinnerungsdispositive.
Indem „Erzählung“ hier in einem weiteren Sinne, als Oberbegriff für narrative Texttypen, die in mündlicher oder in schriftlicher Form (als Interviews, Briefe, Tagebücher, aber auch literarische Texte) vorliegen können, gefasst wird, werden Möglichkeiten und Grenzen verschiedener narrativer Formen und Genres als solche zum möglichen Thema literarischer wie linguistischer Untersuchungen. In besonderer Weise laden Exilerzählungen, die häufig eine Vielzahl von Fluchtorten und wiederholte Grenzüberschreitungen thematisieren, zudem dazu ein, Verfahren und Effekte der Grenzziehung zu reflektieren, die vermeintlich geschlossene Identitäten und Gemeinschaften durch (gewaltsame) Ausgrenzung konstituieren. Narrative Grenzerkundungen in Texten, die Flucht und Exil reflektieren, stellen dabei aber nicht nur immer wieder solchermaßen begrenzte Identitätsentwürfe zur Disposition. Vielfach lassen sie auch alternative Entwürfe hybrider, beweglicher, transnationaler Selbst- und Gemeinschaftsnarrative erkennen.
Im Fokus stehen Emigrations- und Fluchterzählungen von Personen, die 1933-45 auf Grund von rassistischen bzw. politischen Gründen gezwungen wurden, Deutschland, Österreich und andere deutschsprachige Gebiete zu verlassen (für zahlreiche deutschsprachige Flüchtlinge kam auch Shanghai als Zufluchtsort in Frage). Da manche dieser Erzählungen erst lange nach 1945 datieren, sollen auch Fragen des Nach-Exils, der Herausbildung von Diaspora-Strukturen und Perspektiven von Transkulturalität und Translingualität mit ausdrücklichem Bezug zu der historischen Exilzeit erörtert werden. Darüber hinaus sind aber auch Untersuchungen zu deutschsprachigen Gegenwartstexten, die sich Problemen und Implikationen des Erzählens von Flucht und Exil widmen, willkommen.
Die Sektion ist bewusst interdisziplinär angelegt und richtet sich sowohl an Sprachwis-senschaftlerInnen als auch an LiteraturwissensschaftlerInnen